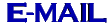Minarett und Mondsichel
Wie sichtbar darf der andere Glaube sein?
von Fulbert Steffensky
Radiobeitrag des NDR, Religion und Gesellschaft, vom 13. Juni 2010
In Deutschland leben etwa 4 Millionen Muslime. Die Hälfte von ihnen hat die deutsche Staatsangehörigkeit, 2,5 Millionen Menschen stammen aus der Türkei, die anderen vorrangig aus Südosteuropa und dem Nahen Osten. Dürfen die Menschen in unserem ohne Zweifel christlich geprägten Land sein, was sie sind: Muslime? Die meisten Deutschen werden diese Frage wohl bejahen. Darf ihre Religion öffentlich werden? Dürfen die Frauen Kopftücher tragen? Dürfen Moscheen gebaut werden, die die Sichtbarkeit des Islam herstellen? Dürfen diese Moscheen gar Minarette haben? Können die Feiertage der Muslime eine öffentliche Bedeutung und einen sichtbaren Platz haben? Da bin ich mir nicht so sicher, wie die Menschen unseres Landes entschieden, wenn es wie in der Schweiz im vergangenen Jahr zu einer Abstimmung käme. Dort jedenfalls hat die Bevölkerung zu 58% gegen die Minarette, also gegen die Sichtbarkeit des Islam gestimmt.
Ein Mittel, einer Idee, einer Gruppe oder einer Religion die Legitimität abzusprechen, ist, ihr die Sichtbarkeit und die Öffentlichkeit zu verweigern. Ein Beispiel verweigerter Öffentlichkeit: die Sprengung der Paulinerkirche in Leipzig 1960. Dies ist der bekannteste Fall einer Kirchensprengung in der DDR, aber es hat viele andere Fälle gegeben. Nach innen, in ihren Gottesdiensten hatten die Gemeinden ziemlich freie Hand. Die öffentliche Sprache und das öffentliche Auftreten aber sollte nach Möglichkeit unterbunden werden. Unsichtbare Kirchen stören nicht.
Den Streit um den anderen Glauben und seine Sichtbarkeit hat es bis in die allerjüngste Zeit auch unter Christen gegeben. Protestanten, die es seit der Reformation im katholischen Salzburg gegeben hatte, hatten es dort immer schwer, und sie durften natürlich keine Kirche bauen. Sie wurden verfolgt und des Landes verwiesen. Die letzten Protestanten der Erzdiözese Salzburg wurden noch 1837 aus dem Tiroler Zillertal vertrieben. In der Lutherstadt Hamburg durften Katholiken lange Zeit keine als solche kenntliche Kirche bauen. Die Kirche wurde dann außerhalb Hamburgs auf der Großen Freiheit gebaut. Im katholischen Köln durften Protestanten im inneren der alten Stadt nicht sichtbar sein. Die erste Kirche wurde auf der anderen Rheinseite gebaut, eben auf der Deutzer Freiheit. 1951 wurde in Zürich die katholische Dreikönigskirche eingeweiht. Sie besitzt bis heute
keinen Glockenturm, weil die städtische Gemeinde nur eine Kirche ohne Turm und Glocken duldete. Im Grundbucheintrag der Liegenschaft jener Gemeinde heisst es. "dass dieses Land nicht für katholische Zwecke" überbaut werden dürfe. Wir schütteln heute den Kopf über diese Unvernunft. Worüber werden unsere Kinder den Kopf schütteln?
Wem man die Sichtbarkeit verbietet, dem verbietet man die Existenz. Warum ist die Sichtbarkeit für eine Idee und einen Glauben wichtig? Man wird auch zu dem, als der man sich vor anderen zeigt und bezeugt. Man ist der, als der man gesehen und wahrgenommen wird, und man kann sich nicht in seinen Absichten, Wünschen und Optionen verbergen, ohne dass diese nicht selbst verblassen. Ein Glaube braucht Öffentlichkeit, die Präsenz des Geistes brauch Repräsentation. Wenn man sich nicht zeigt, weiß man nicht, wer man ist. Religiöse Gebäude sind also immer
"Konfessionsgebäude". Sie sind ein steinernes Glaubensbekenntnis. Natürlich kann man auch einen falschen Glauben bekennen, und die Gebäude werden damit gefährlich, wie auch viele Kirchen gefährliche Demonstrationen von Macht und Überlegenheit über andere waren. Das aber ändert nichts an dem grundsätzlichen Gedanken, dass das Recht auf Öffentlichkeit ein Grundrecht religiöser Freiheit ist. So hat der liberale säkulare Staat, in dem wir leben und der religiös neutral ist, nicht nur die Freiheit eines Bekenntnisses zu schützen, sondern auch die Freiheit der Öffentlichen Darstellung eines Bekenntnisses.
Warum bestreitet eine religiöse Gruppe der anderen ihr Lebensrecht? Es ist ihr Zwang zur Einzigartigkeit. Die Grundgefahr religiöser Systeme ist, dass sie sich nicht endlich denken können. Sie sind oft in der Gefahr, sich selber Gottesprädikate zuzulegen: sie sind die allein Seligmachenden, außerhalb von ihnen gibt es kein Heil, sie sind die Wahren, und außerhalb von ihnen ist nur Lüge und Abfall. Ihre Gefahr ist, die Welt zu säubern von den Andersheiten. Der Zwang zur Einstimmigkeit lässt sie nur schwer Fremdheiten denken und dulden. Der Verlust der Endlichkeit ist der Verlust der Geschwisterlichkeit. Nur Wesen, die sich als endlich begreifen, sind
geschwisterliche Wesen. Sich für einzigartig zu halten, heißt immer, bereit sein zum Eliminieren. Die Anerkennung von Pluralität ist die Grund-bedingung menschlicher Existenz, so ungefähr hat es Hannah Arendt formuliert. Ich wünsche mir eine Kirche und religiöse Gruppen mit Konturen. Zugleich wünsche ich mir eine Religion, die Gott unendlich sein lässt und auf ihre eigene Unendlichkeit verzichtet. Erst sie ist fähig zum Zwiegespräch. Selbstverständlich ist eine solche Kirche eine Missions-kirche. Mission heißt, zeigen wer man ist und was man liebt. Gesicht zeigen, heißt Gesicht gewinnen.
Ich wünsche uns den Mut zur Endlichkeit. Ich wünsche uns die Gnade der Endlichkeit. Sie erleichtert uns das Leben. Wir als Einzelne, wir als religiöse Gruppe, wir als Nation sind nicht die Garanten der Welt. Wir sind nicht der Grund des Lebens, das ist Gott, in ihm sind das Leben und die Wahrheit begründet. So können wir Fragment sein, auch als religiöse Gruppe. Welche Lebensleichtigkeit, dass wir nicht alles sein müssen! In uns muss nicht die ganze Wahrheit zu finden sein. An unserem Wesen muss die Welt nicht genesen. Ein Nazi-Satz hieß: Am Deutschen Wesen soll die Welt genesen. Welche Aggression mit solchen Sätzen verbunden war, haben wir in Erinnerung. Wir können uns als religiöse Gruppe die Freiheit nehmen, nicht absolut zu sein. Damit sind wir von der Last der Einzigartigkeit befreit. Und das ist dann zugleich der Lebensraum für andere; für andere Wahrheiten, andere Lebens-entwürfe, andere Hoffnungen. Ich bin einer unter vielen, mein Glaube ist einer unter vielen, mein Land ist eines unter vielen. Das drückt nicht meinen Mangel und meine Geringfügigkeit aus. Alle Lebensdialekte stammen von der Grundsprache des Lebens. So gilt beides: Der andere Glauben ist anders als meiner, und ich kann ihm seine Andersheit lassen. Er ist mir gleich, denn wir haben den gleichen Ursprung des Lebens. Andere Lebens-entwürfe, andere Hautfarben, andere Religionen brauchen also nicht auf dem Altar meiner eigenen Wahrheit geopfert zu werden. Die Menschen im anderen Glauben sind meine Geschwister - Menschen wie ich und Menschen anders als ich. Gott spricht in Dialekten. Im Talmud heißt es: "Die Sprache des einen und die Sprache des anderen ist die Sprache des lebendigen Gottes." Und der jüdische Philosoph Levinas sagt: "Die Sprache Gottes ist eine mehrzahlige Sprache."
Das Bewusstsein der eigenen Endlichkeit als Freiheitsbewusstsein, die Gelassenheit und die Gewaltlosigkeit dem anderen Leben gegenüber stammen aus der Gewissheit, dass man selber kein niemand ist. Die Güte hat uns ins Leben gerufen und uns unsere Wahrheit geschenkt. Ich vermute, dass Toleranz nur da gelingt, wo man sich seiner halbwegs gewiss ist. Man muss wissen, woher man kommt und wer man ist; man muss die eigenen Geschichten und die eignen Lieder kennen. Es
gibt eine hinfällige Toleranz, die aus resignativer Selbstschwäche entsteht; die aus dem Bewusstsein entsteht, es rentiere sich nicht, gegen etwas zu sein, weil man sich selbst verschwommen ist und weil man verzweifelt ist an der Erkennbarkeit der Wahrheit. Eine auf andere wirklich bezogene, eine dialogische und starke Toleranz setzt Lebensgewissheit voraus; setzt also voraus, dass man sich selber kenntlich ist. Zur dialogischen Toleranz gehören Partner, die voneinander verschieden sind, die Eigentümlichkeiten haben und deren Grenzen erkennbar sind. Der symbiotische Wunsch, alle Grenzen niederzureißen unter Verleugnung aller Unterschiede zerstört die Dialogfähigkeit. Man muss jemand sein, um sich zu jemandem verhalten zu können.
Nun habe ich nicht nur ein Problem mit religiöser Enge und mit einem Einmalig- keitsfanatismus. Ich habe auch Probleme mit dem interreligiösen Flanieren und mit gewissen Dialogzwängen. Ein erstes Beispiel: Eine evangelische Gemeinde hat in diesem Jahr nicht den Karfreitag gefeiert mit seinen Traditionen und Liedern. Sie hat stattdessen die jüdische Pessahliturgie gefeiert. Ein jüdischer Theologe und Freund hat mir darauf gesagt: Seit ihr uns nicht mehr umbringt, seid ihr nicht mehr aus unseren Vorgärten zu vertreiben. Ein zweites Beispiel, eine Ostertagung in einer christlichen Akademie. Am Gründonnerstag: Ein jüdisches Seder-Mahl; anschließend Feier der buddhistischen Liturgie "Tor des süßen Nektars". Am nächsten Tag, am Karfreitag: "Ahnenreise" - Feier einer schama-nischen Liturgie, danach noch ein "Kreuzweg ins Licht". Das nun ist Schwachsinn pur! Man kann nicht ständig alle Dialekte vermischen. Je selbstverständlicher wir anderen ihre Selbstverständlichkeit lassen, umso weniger brauchen wir dauernd beieinander zu hocken. Wir sind nicht die anderen. Die anderen sind nicht wir. Unsere Verschiedenheit ist unser gemeinsamer Reichtum.
Wer weiss, wer er ist, weiss auch, wer er nicht ist. Es gibt Grenzen, die zu respektieren sind, wenn man sich nicht in einem Allgemeinen und Abstrakten verlieren will. Grenzen müssen ja nicht feindlich sein. Sie stören das Gespräch nicht, sie ermöglichen es. Man muss einer sein, um jemanden begegnen zu können. Man muss eine Sprache haben, um mit anderen sprechen zu können. Ein religiöses Esperanto gibt es nicht. Warum eigentlich sollen die verschiedenen religiösen Gruppen ständig im Gespräch sein? Wenn sie einander schätzen; wenn sie einander das Lebensrecht nicht absprechen, können sie sich doch auch in Ruhe lassen.
Es gibt das Problem der Flucht in die Fremde, weil man dem eigenen Reichtum nicht traut, weil man ihn nicht kennt und weil man nicht gelernt hat, ihn schön zu finden. Die Voraussetzung eines jeden interreligiösen Gespräches ist die Fähigkeit, die eigenen Schätze zu lieben und charmant zu finden.
Wir sind nicht alles, wir sind endlich als Christen, als Jüdinnen, als Muslime und als Buddhistinnen. Wir sind nicht alles, aber wir sind lebendiger Teil von allem, und wir sind wahrheitsfähig. Aus dieser Gewissheit müsste man auch miteinander streiten können. Ökumene heißt nicht die geglückte Selbstliquidation in ein Allgemeines. Wir sollen nicht in ein blasses Allgemeines von Gesinnung, Lebensauffassung und Expression ver- schwimmen. Der Dialog soll jedem zu seiner geläuterten Eigentüm-
lichkeit verhelfen. Ökumene heißt nicht nur, dass ich geduldet bin mit meiner Wahrheit, sondern dass ich nicht im Stich gelassen werde von der Wahrheit der anderen. Ich bin Fragment, ich weiß etwas, aber ich weiß nicht alles. So brauche ich die Korrektur und die Ergänzung durch die Wahrheit der anderen. Dialogische Ökumene, wenn sie nicht verzweifelt und wahrheitsdefätistisch ( im Blick auf die Wahrheit hoffnungslos und mutlos ) ist, sucht den anderen auf, sie lernt, lehrt und streitet. Die Wahrheit entsteht und kommt voran im Gespräch der Geschwister. Sich selber sowohl für wahrheitsfähig als auch für irrtumsfähig zu halten, das ist eine Eigenart dialogischer Ökumene. Wo man ins Gespräch kommt, da stoßen Wahr- heiten und Irrtümer aufeinander, da gibt es Auseinandersetzungen, da gibt es Streit. Der Streit ist ein Mittel, die Wahrheit zu ermitteln, aber nur unter der Bedingung, dass Men- schen ihn austragen, die strikt auf Gewalt verzichten. Wir leiden nicht nur an Intoleranz, wir leiden auch an Harmoniediktaten und an Einigkeitssüchten, die die Wahrheit vernach-lässigen. Der Streit verträgt das Licht der Öffentlichkeit, wo auf Gewalt verzichtet wird und wo nicht Schmähung, sondern Verständigung das Ziel ist.
Eine praktische Streitfrage: Können Kirchen, die von Christen aufgegeben werden, Moscheen werden? Es ist eine Testfrage an die Glaubwürdigkeit des Dialogs. Ich wurde in diesem Streit gefragt, ob ich wisse, wie engherzig Christen in islamischen Ländern behandelt werden. Ich wurde gefragt, ob ich mir vorstellen könne, dass Muslime den Christen eine Moschee für ihre Gottesdienste zur Verfügung stellen. Ja, ich kenne die Intoleranz vieler islamischen Gruppen und Länder. Nein, ich kann mir nicht vorstellen, dass Christen in Moscheen beten dürfen. Aber es fällt mir nicht ein, die Intoleranz dieser Gruppen und Länder zum Maßstab meiner Toleranz zu machen. Die katholische Deutsche Bischofskonferenz hat es beim Schweizer Minarettenstreit so formuliert: "Gerade weil wir Christen die Einschränkungen der Religionsfreiheit in muslimisch geprägten Ländern ablehnen und verurteilen, setzen wir uns nicht nur für die Rechte der dortigen Christen ein, sondern auch für die Rechte der Muslime bei uns." "Wir dürfen unsere Kirchen nicht preisgeben!", sagte ein Bischof in dem Streit um die Benutzung einer aufgegeben Kirche durch Muslime. Ja, geben wir sie denn preis, wenn wir unser Haus anderen Weisen des Glaubens leihen, das wir selber nicht mehr brauche? Könnte es sein, dass nicht nur der Islam intolerant ist, sondern dass wir auch als Christen und als Kirchen unsere eigene Endlichkeit noch nicht erkannt und respektiert haben? Noch einmal: Nur Gruppen, die sich ihrer Be- grenztheit bewusst sind, können geschwisterlich miteinander umgehen. Toleranz heißt nicht nur, die anderen Gruppen ihre Wege gehen lassen. Es heißt auch, die anderen nicht im Stich lassen. In Bielefeld wurde eine Kirche nicht mehr gebraucht. Sie ist nun ein edles Restaurant. Kein Mensch hat sich darüber aufgeregt, dass diese Kirche zu einem Fresstempel wurde. Im selben Bielefeld wurde eine evangelische Kirche entwidmet. Sie sollte dann der jüdischen Gemeinde zur Verfügung gestellt werden. Es gab einen riesigen Protest mit der Besetzung dieser Kirche. Merkwürdig, dass die Bar in der einen Kirche nicht verstört, wohl aber, dass die andere Kirche ein Gebetshaus eines anderen Glaubens werden sollte.
Ich war vor einigen Tagen in Hirsau, in einem kleinen Ort nahe Calw im Schwarzwald. Seit Mitte des 9. Jahr- hunderts war es ein zentraler Ort christlich-bene-. diktinischen Geistes. Die Ruinen des Klosters St. Peter und Paul sah ich dort, den gut erkennbaren Grundriss der großen Klosterkirche und ich sah die bewegend schöne Kirche St. Aurelius, die nur noch in ihrem Langhaus erhalten ist. Im Gespräch wurde ich gefragt: "Können Sie wünschen, dass an diesem Ort christlichen Ursprungs ein Minarett gebaut wird?" Ich fühlte, dass ich dies nicht wünsche. Es muss ja auch nicht sein. Schließlich will ich ja auch nicht unbedingt eine Kirche in Mekka mit einem hohen Turm. Aber es gibt an diesem Ort eine muslimische Gemeinde. Auch sie hat Wünsche, und so würde ich nicht gegen ein Minarett in Hirsau stimmen. Aber es würde mich schmerzen, wenn es dort entstände. Es gibt den Schmerz der Endlichkeit; den Schmerz darüber, dass wir auch an diesem urchristlichen Ort nicht mehr allein sind. Ich brauche diesen Schmerz nicht zu verleugnen. Die anderen anders sein und leben zu lassen, ist nicht leicht. Aber mein Schmerz gibt mir nicht das Recht, anderen Schmerzen zuzufügen. Übrigens ist dieser Ort auch ein Beispiel muslimischen Großmuts. Weil es ein so bedeutender Ort christlicher Geschichte ist, hat die muslimische Gemeinde auf das Minarett verzichtet.
Ich schließe mit einer Geschichte, die ich in Christa Wolffs Buch "Kassandra" finde. Die Bewohner der Stadt fragen Kassandra: Wird diese unsere Stadt bestehen bleiben? Die Antwort der Seherin: Wenn ihr aufhören könnt zu siegen, wird eure Stadt bestehen. Sie fügt hinzu: Ich kenne keine Sieger, die aufhören könnten zu siegen. Und dann mit verzweifelter Hoffnung: Ich kenne die menschliche Natur nicht genug.
Vielleicht gibt es einmal Menschen, die ihre Siege in Leben verwandeln. Vielleicht werden wir es alle lernen: Aufhören über einander zu siegen. Vielleicht werden wir es lernen, die Siege in Leben zu verwandeln. Dann werden unsere Städte bewohnbar. Dann wird unser Glaube zu einer bewohnbaren Sprache, in dem auch noch unsere Kinder wohnen wollen.

 H E I M A T V E R E I N D I N S L A K E N
H E I M A T V E R E I N D I N S L A K E N