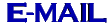Dinslaken − mit dem lieben Gott verschwistert.
von Peter Pollmann, Vorsitzender des Bürgervereins (Bonn)-Roleber-Gielgen (gebürtiger Dinslakener)
|
Oder soll man sagen: verschwägert? Jedenfalls eine besondere Partnerschaft. Sie beruht auf der Aussage von Hans Dieter Hüsch, er sei dem lieben Gott in Dinslaken begegnet. Der käme von Zeit zu Zeit mit dem Fahrrad, um seiner Schwester in der Wäscherei zu helfen, zu Weihnachten etwa, weil dann die meiste Arbeit ist. Tatsache ist auch, dass der Ehemann der Schwester, Gott’s Schwager, wenn man so sagen darf, auf Zeche verunglückt ist und seit langer Zeit bettlägerig. Das ist für den lieben Gott (im weiteren Text: d. l. G.) eine starke Mo- tivation zu kommen, und ein Motiv braucht auch d. l. G., wenn er glaubwürdig gekommen sein will. Und das Wäschereischild. Ein starker Beweis. Ein blau-weißes Schild auf einer Giebelmauer. Aber hinten raus. Vorne an der Duisburger Straße - keine Wäscherei. Aber wenn man den Durchgang bei der Rittergasse nimmt und vom Rathaus her auf die hinteren Giebelmauern schaut, liest man: „Dampfwäscherei Heißmangel, SCHNEEWEISS, Kittel Oberhemden Schnelldienst, Inhaber: H. Tel. 51087“ Das ist es, nicht mehr und nicht weniger. Ein ungemein starker Beweis, der nicht zuviel, aber auch nicht zu wenig verrät. Inhaber H. und eine kryptische Telefonnummer. Das Geheimnis wird gleichermaßen gewahrt und ent- hüllt. Indirekte Mitteilung, dialektische Theologie! Man ist nichtsdestoweniger versucht, noch andere starke Motivationen zu finden, dass d. l. G. nun gerade Dinslaken sosehr bevorzugt. Man könnte sagen: Er sucht die Armen und die Elenden auf. Da ist er ja vielleicht in Dins- laken am Rand des sterbenden Industriegebietes gerade richtig. Man erwartet Bilder großer Not, Folgen äußerer und innerer Verwahrlosung, wie sie die Arbeitslosigkeit zeitigt. Man sucht nach verfallenden Arbeiter- und Zechenhäusern, leeren Industriebrachen hinter rostigen, schiefen Fabriktoren, Industriebahnschienen, die im Nichts enden. Nun, man sieht fast nichts dergleichen, aber die Häuser: adrett bis zum letzten in der Stadt und vorbildlich bis idyllisch in der Zechenkolonie, inmitten der übrigens die Bürgermeisterin wohnt, von der CDU und um Integration bemüht, denn sie wohnt unter lauter Türken. Nicht, dass diese nicht in die Innenstadt kämen. In der Fußgängerzone auf der Neustraße ein Gewimmel von Orienta- len und Okzidentalen, die sich an den Auslagen der Handygeschäfte, der Klamottenmärkte, der Ramschläden, aber auch vornehmer Etablissements erfreuen und die Cafés und Eis- dielen bevölkern. Man lebt und lässt leben. Dinslaken – ein erfreuliches Städtchen, nach irdischen Maßstäben. Darin also keine Motivation für d.n l.n G., gekommen zu sein. In der obengenannten fröhlichen Neustraße gibt es immerhin eine Lücke. Eine Art Baulücke, ein Geschäftshaus, das die Fluchtlinie flieht. Ein Gedenkstein davor, eine Art Altar, auf dem eine Tafel daran erinnert, dass hier das jüdische Waisenhaus stand, dessen Insassen am 10. November 1938 daraus verjagt und zum Hohn, die Kleineren auf einem Leiterwagen, den die Großen ziehen mussten, durch die Stadt getrieben wurden. Sie landeten in einem alten Wirtshaussaal und waren da mit anderen Dinslakener Juden viel schlechter untergebracht als in ihrem Waisenhaus, erbärmlich schlecht. Immerhin, die meisten von ihnen kamen durch die tapfere Hilfe anderer Juden und Nichtjuden über Köln, über Belgien und Holland davon. Ein kleines Wunder? Die Dinslakener haben die Geschichte festgehalten mit einer bronzenen Skulptur, die im Stadtgarten steht: ein Leiterwagen, darauf allerdings nicht verschüchterte Dinslakener Judenkinder (wie hätte man sie auch darstellen sollen?), sondern Schuhe und Kleider, wie sie in Eile angehäuft vor den Duschen von Auschwitz zurückblieben. Ein Schuld- bekenntnis der Dinslakener und ein liebevolles Gedenken der verfolgten Kinder damals. Kommt deshalb d l. G. hierher? Noch ein anderes Denkmal der gleichen Art hat der Künstler Alfred Grimm in Dinslaken geschaffen: Eine Erinnerung an Schwester Marie Euthymia, alias Emma Üffing, die 1914 in Holverde geboren, 1934 als Clemens-Schwester nach Dinslaken ans katholische St. Vinzenz-Krankenhaus kam und von 1943 bis 1945 die Kriegsgefangenen und Fremdarbeiter in der Barbara-Baracke betreute. Anlässlich ihrer Seligsprechung durch Papst Johannes Paul II. im Jahr 2001 hat Alfred Grimm im Innenhof des Krankenhauses einen ihrer Arbeitsplätze in der Baracke nachgebaut, in Bronze, wenn ich das Material recht erkenne, das Dach angedeutet über dem ärmlichen Nachttisch und der Pritsche, allerdings eher nach der Art eines weihnachtlichen Stalles mit rustikalen Balken, vergleichsweise noch hübsch, wenn man an die groteske Hässlichkeit der Baracken mit ihre scheußlich drohenden Fensterfronten denkt. Nichtsdestoweniger ein ein- drückliches und liebevolles Denkmal in diesem kleinen Park, in dem an warmen Sommer- tagen die Rekonvaleszenten sitzen, wenn’s Wetter schlechter ist in der direkt angrenzenden Caféteria des Krankenhauses. Ein wichtiger Helfer für Schwester Euthymia war der franzö- sische Priester Emile Esch, der auch oft dolmetschen konnte zwischen der selbstlosen Hel- ferin und den hilf- und heimatlosen Kranken. Im Jahr 1961 kam er noch einmal zurück nach Dinslaken, konnte von seinem schweren Dienst damals berichten, und, was er vorher nicht ahnen konnte, blieb hier für immer. Er starb in den Tagen seines Besuches am Ort seiner Verbannung, aus seiner einstigen Knechtschaft ging er heim in die ewige Freiheit. Als ob d. l. G. es sich ausgedacht hätte. Der Tod, wie überall ein prominenter Gast und zum Kriegs- ende in Dinslaken besonders. Noch am Tage bevor die Amerikaner über den Rhein setzten und mit der kampflosen Einnahme der Stadt für Dinslaken das Ende des Krieges setzten, kamen die Bomber. Nicht mehr von den großen Basen in England, sondern im Pendelver- kehr von dem kleinen Einsatzflughafen bei Venlo, den ganzen Morgen. Eine tolle logistische Leistung für die Piloten und das Bodenpersonal, und ein nicht enden wollender Schrecken für die Dinslakener. Für 900 von ihnen war’s der Tod. An demselben Tag sank auch das ehe- malige jüdische Waisenhaus in Schutt und Asche, das die Gewalthaber von damals im Triumph in ein Haus der Partei verwandelt hatten: Hohn auf den Hohn. Kein Wunder. Damals wurde auch die katholische Pfarrkirche zerstört, der Turm sackte endgültig erst nach vier Wochen zusammen. Heute sind Kirche und Turm wieder aufgebaut, die Kirche im Innern stark verändert, aber mit dem eindrücklichen Kruzifix und einem Antwerpener Schnitzaltar, die erhalten blieben. Die evangelische Kirche blieb im Ganzen verschont, ein hübsches Ding, in der Barockzeit erbaut, mit schönen Kirchenfenstern von Werner Persy, zeitgenössisch, aber gut zu lesen. Die Kreuzigung vor einer Kulisse von Industrieschloten und Hochhäusern, um das Kreuz Leute von heute. Die zwölf anderen Fenster mit biblischen Geschichten von der Schöpfung bis zur Speisung der Fünftausend, links aus dem Alten, rechts aus dem Neuen Testament. Sehr schön auch von außen anzusehen, wenn die Kirche im Dunklen von innen leuchtet. Ob der Tod das Besondere an Dinslaken ist, das d.n l.n G. hierher zieht? Da gibt es noch einige Erinnerungen aus den letzten hundert Jahren, die kein Denkmal feiert. Ein vergessener Krieg, der Arbeiteraufstand im Ruhrgebiet 1920, der als Abwehr des Kapp- Putsches in Berlin entstand und sich zum heiligen Krieg der Spartakisten um den Sieg des Proletariates aufblähte. Aus der Kolonie Lohberg sollen 400 Bergleute dabei gewesen sein. Die letzten Gefechte fanden an der Lippe vor Wesel statt. Dinslaken diente als wichtige Etappenstadt. Über Hundert Rotarmisten wurden auf dem Rückzug bei Voerde wie die Hasen abgeschossen, andere, Gefangene, darunter sieben Frauen, die als Sanitäterinnen dabei oder zum Kartoffelschälen eingesetzt waren, einfach an die Wand gestellt. Reichswehr und Freikorpsleute, gegen Kapp hatten sie keinen Finger gerührt. Bis 1933 zog in jedem Jahr eine Delegation aus Lohberg zum Friedhof nach Dinslaken, wo beim Massengrab der Ge- fallenen und standrechtlich Erschossenen ein Gedenkstein errichtet war. Dort legten sie einen Kranz nieder. In Lohberg wurde der Bergwerksdirektor Sebold von Rotfrontkämpfern brutal ermordet. Sein Grabstein steht wohl noch, während der für die Arbeiter natürlich 1933 entfernt und nicht wieder errichtet wurde. Ob denn der Lagerarzt von Auschwitz, der 1946 in Hameln verurteilt und hingerichtet wurde, dann aber in Dinslaken bestattet, einen Grabstein hat? Eine Geschichte aus der Notzeit Lohbergs. In der Zechensiedlung war um 1930 längst die Arbeitslosigkeit eingezogen. Aber man träumte von der großen Sowjetunion als dem Paradies der Werktätigen. - Und in ihrem Arbeiterglauben verkauften Familien alles, was sie hatten und machten sich nach Osten auf, ins Donezgebiet, das Industrierevier in der Süd- ukraine. Sie kamen ganz schnell mit allen Anzeichen des Entsetzens und nun bettelarm zurück, kein Wunder. Mir fiel dazu ein, was in Matthäus 8, 10 steht: Wahrlich, solchen Glau- ben habe ich in Israel nicht gefunden. Ich gestehe, dass mich diese Geschichte rührt. “Mich wundert’s, dass ich so fröhlich bin.“ Wem kommt nicht der alte Vers in den Sinn, wenn er dies alles liest? Weil das Alter dieses Verses ja auch deutlich macht, dass Not und Tod, Krieg, Krankheit, Hass und Hunger überall und zu allen Zeiten am Tisch oder auf dem Dach sitzen. Und insofern ist Dinslaken überall. Das meint auch Hans-Dieter Hüsch. D. l. G. kommt nicht - wenn man mal von seiner Schwester absieht – deshalb oder darum, sondern einfach so. Und Dinslaken ist für ihn kein besonderer Ort, sondern ein ganz normaler (aber eben am Niederrhein!). Man braucht keine Klimmzüge zu machen, moralische nicht und gei- stige nicht, nicht einmal geistliche. Das ist es. Gott ist menschennah. Das ist zwar einige Male schon von Kanzeln gepredigt worden, aber greift niemand mehr so richtig ans Herz. Anders, wenn d. l. G. mit dem Fahrrad kommt und verspricht, am 2. Weihnachtstag die Hüschs zu besuchen, weil er so gerne die Reste vom Braten und vom Kuchen isst – das hat was! Das macht, dass die, denen eben in der Kirche das Eigentliche des Weihnachts- festes eingeschärft worden ist, noch etwas seliger Weihnachten feiern. Auch der Komparativ stammt von Hüsch. So gut wie am Niederrhein kann man eben nirgendwo Weihnachten feiern, sagt auch d. l. G. Er ist eben nicht nur allzumenschlich, sondern auch provinziell. Das ist Nähe. Sagt mir nicht: ja, nach dem Schema, den Niederrheinern ein Niederrheiner. Nein, der Niederrhein ist objektiv besonders schön. Nur merkt es nicht jeder. Na, dann also doch subjektiv. Diese Welt in Liebe begreifen als eine gute Gabe d. l. G.s mit kleinen Fehlern, das kann man besonders gut am Niederrhein - und anderswo. Und heiter sein. Weil man es manchmal sein muss, bei Wetter und Gegenwind. Man wundert sich nicht, dass Hüsch oft auch auf Kanzeln oder Kirchentagen gepredigt hat. Nicht soviel wohl vom totaliter aliter, von doppelter Praedestination, von der Zwei-Reiche-Lehre, von alleinselig- machenden Kirchen, sondern mehr von Lachen und Weinen und der grenzenlosen Güte Gottes. Bei allem Spaßfaktor entdeckt mancher auch leise Kritik an Predigten, die mehr Theologie, vielleicht auch Politik oder Historie sind als Evangelium. Oder Moral. Von Hüsch habe ich dann auch die Nachricht, dass d. l. G. aus der Kirche ausgetreten sei. Als besorgte Christen sich an die Bischöfe wandten und um Erklärung baten, drucksten die herum. Dann meinten sie, dass d. l. G. leider ja auch je länger je mehr zu einer Belastung geworden wäre „wegen seiner alten Krankheit, alle Menschen gleich zu lieben, seiner fassungslosen Milde, seiner gottverdammten Art und Weise, alles zu verzeihen und zu helfen, wegen seiner Vorliebe für die, die gar nicht an Ihn glauben.“ Und, darf ich hinzufügen, weil er einen Himmel für die Tiere aufgemacht hat. Hans-Dieter Hüsch ist dagegen seiner Kirche treu geblieben, bis zuletzt. Aber was heißt zuletzt? Also bitte ich alle Reisenden nach Dinslaken, diese schöne, fröhliche Stadt zu genießen, sie ist eine der vielen guten Gaben Gottes. Lernen Sie ihre immer noch anheimelnde Innen- stadt, gemütlichen Cafés und Restaurants, die Vielzahl der Geschäfte und das liebevoll be- treute kleine Museum kennen, das vergnüglich informiert, ohne zu ermüden. Man kann die Erinnerungsstätten an das Schicksal der jüdischen Mitbürger und an das Wirken S. Euthy- mias im St. Vinzenzkrankenhaus besuchen (mit Cafeteria, wie oben beschrieben). Man kann die Kirchen besuchen oder auch nicht, und man kann die Vorübergehenden fragen (oder fragen lassen), ob sie wissen, dass d. l. G. gelegentlich die Stadt besucht. Die Antworten müssten interessant sein.
Zum Schluss noch eine Nachricht und ein starker Beweis: ten angerufen: Hans-Dieter Hüsch hätte doch heute seinen Auftritt in der Stadthalle. Ob man nicht, wenn er nach der Vorstellung aus dem Bühnenausgang kommt, prüfen könnte, ob er d.n l.n G. wiedererkennen würde, wenn er noch einmal käme. Dazu müsste er – der Pfarrer – sich wie d. l. G. anziehen, nämlich wie ein niederrheinischer Landstreicher: Halbe Jacke, Manchesterhose, Pletschkappe und mit dem Fahrrad kommen. Er müsse alles noch einmal nachlesen, was Hüsch von der ersten Begegnung geschrieben habe und was dabei ge- sprochen worden sei. Und auswendig! Tat der Pfarrer – er heißt Schneider -, besorgte die Klamotten und lernte alles auswendig. Als die Tür vom Bühnenausgang aufging, kam er mit dem Fahrrad, hielt an, wollte absteigen, dabei fiel er fast hin, genau wie das erste Mal d. l. G. Und tatsächlich: Hüsch fing ihn auf, freute sich, wie der Pfarrer den Flachmann aus der Aktentasche holte und sich bedankte und erkannte d.n l.n G. natürlich wieder. Er ist dann mit ihm noch einen Kaffee trinken gegangen im Stehcafé an der Neustraße, genau wie sie das damals auch gemacht hatten. Ist das nicht auch ein starker Beweis dafür, dass d. l. G. wirklich Hans-Dieter Hüsch erschienen ist, dass er beim zweiten Mal direkt erkannt hat, dass der Pfarrer Schneider d. l. G. sein sollte? (Beweisführung nach Hebräer 6,13 - 18) Und wer immer noch nicht glauben will, dass dies alles seine Richtigkeit hat, der soll mir mal sagen, ob ein Journalist eine solche Erleuchtung haben kann, einen solchen klugen Vorschlag zu machen. Das ist ein beglaubigendes Wunderzeichen. |

 H E I M A T V E R E I N D I N S L A K E N
H E I M A T V E R E I N D I N S L A K E N